|
|
FREUNDE DES RIESKRATERMUSEUMS e. V. |
|
|
|
|
|
FREUNDE DES RIESKRATERMUSEUMS e. V. |
|
|
|
|
Tag des offenen Steins am 07.12.2025 |
|||||
|
|||||
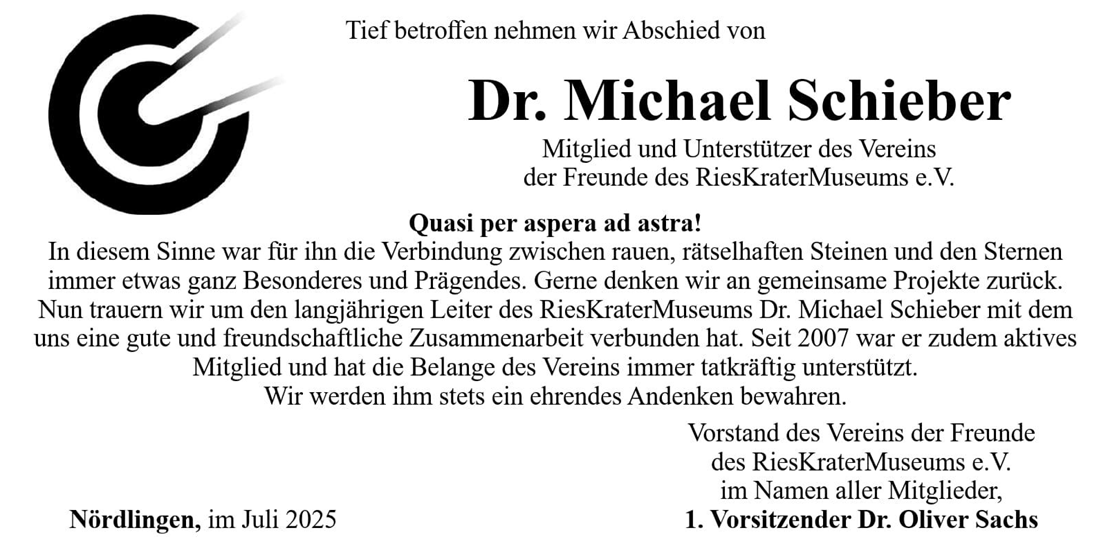 |
|||||
|
Michael Schieber |
|||||
|
|||||
|
Am 5. Juli 2025 verstarb Dr. Michael Schieber im
Alter von 78 Jahren in Stuttgart.
Michael Schieber
wurde am 22.12.1946 in Amberg in der Oberpfalz als Sohn eines
Polizeibeamten geboren. Von 1953 bis 1957 besuchte er die
Grundschule in Amberg und wechselte dann auf das
Hans-Leinberger-Gymnasium in Landshut, wo er 1968 das Abitur
ablegte. Nach seinem Wehrdienst studierte er zwischen 1970 und 1974
zunächst an der Universität Regensburg Mathematik und später für das
Lehramt Geografie und Physik. Die Zeit zwischen 1974 bis 1977
verbrachte
Michael Schieber
an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, um sich in Physischer
Geografie, Geologie und Bodenkunde zu vertiefen. 1977 schloss er
sein Studium nicht nur ab, sondern heiratete – entsprechend seinem
herzlichen und humorvollen Wesen – am 1. April 1977 seine Frau
Margarete. Ihre erste gemeinsame Tochter Kathrin wurde schließlich
am 16. Januar 1979 geboren, sieben Jahre später folgten am 9. Mai
1986 die Zwillinge Julia und Michaela. Michael Schieber arbeitete nach seinem Studienabschluss von 1978 bis 1988 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geographischen Institut der Universität Regensburg. Bereits zu dieser Zeit beschäftigte er sich im Rahmen zahlreicher Studentenexkursionen mit dem nordschwäbischen Meteoritenkrater „Nördlinger Ries“. Zu jener Zeit promovierte Michael Schieber im September 1981 an der Justus-Liebig-Universität in Gießen über das Thema „Bodenerosion in Südafrika – Vergleichende Untersuchungen zur Erodierbarkeit subtropischer Böden und zur Erosivität der Niederschläge im Sommerregengebiet Südafrikas“. Weitere internationale Erfahrungen sammelte er 1982 an der Universität der afrikanischen Republik Transkei in Umtata (heute: Mthatha) als Lehrbeauftragter für Geographie und Bodenkunde. Zwischen dem 1. Mai 1989 und dem 30. Juni 1990 war er wissenschaftlicher Leiter des Naturkundemuseums Ostbayern in Regensburg. Beim Umbau und der Neukonzipierung des Museums vertiefte er seine Kenntnisse als Konservator und konnte diese bei der Bewahrung der Kulturgüter und zudem bei der Vermittlung der Bestände für die breite Öffentlichkeit einfließen lassen. Hier galt sein besonderes Augenmerk den geologisch-mineralogischen Sammlungen, aus denen schließlich die neue Abteilung „Geologie Ostbayerns“ hervorgegangen ist. Nachdem am 6. Mai 1990 in Nördlingen das RiesKraterMuseum feierlich eröffnet wurde, setzte Michael Schieber am 1. Juli 1990 seine berufliche Tätigkeit als neuer Leiter dieses weltweit einzigartigen Museums fort und übernahm zunächst kommissarisch die Leitung des „Arbeitskreises Geologie“ im Verein der Rieser Kulturtage. Im RiesKraterMuseum selbst wirkte er fast 20 Jahre, bis er gesundheitsbedingt am 31.12.2010 feierlich in den Ruhestand verabschiedet wurde.
Er prägte das
RiesKraterMuseum zwei Jahrzehnte erfolgreich mit seiner fachlichen
Kompetenz und führte seine Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter mit
Respekt und Herzlichkeit. So erlangte das Museum nach kurzer Zeit
Akzeptanz und weltweite Wahrnehmung. Er brachte das Nördlinger Ries
mit seiner außergewöhnlichen Geologie und Geographie vielen
Schülern, Studenten, interessierten Laien und Wissenschaftlern in
Form von Vorträgen, Berichten und Publikationen nahe. Seine
inspirierenden Referate vor Geowissenschaftlern und Fachtagungen
oder im Rahmen besonderer Anlässe an den Sternwarten renommierter
astronomischer Gesellschaften gehaltenen Vorträge waren stets ans
jeweilige Publikum angepasst, wodurch sie immer ein zahlreiches und
sehr interessiertes Publikum fanden.
Michael Schieber
verstand es, seine Zuhörer zu fesseln und ihnen in verständlicher
Weise die anspruchsvolle Thematik der Erforschung und Entstehung des
Nördlinger Rieses näher zu bringen. Aber auch als freundlicher
Gastgeber für so mache Veranstaltung, wie beispielsweise der nur
alle zwei Jahre stattfindenden Rieser Kulturtage, bleibt
Michael Schieber
stets in guter Erinnerung. Ebenso fanden seine
Publikationen bei der jeweiligen Leserschaft großen Anklang, sei es
nun in den Heimatbüchern der Gemeinden Deiningen, Hainsfarth, Otting
und Gunzenheim oder jenen in den geowissenschaftlichen Journalen. An
dieser Stelle soll die für den Bericht Nr. 253 der Akademie für
Lehrerfortbildung Dillingen hergestellte Handreichung besonders
hervorgehoben werden. Aus dieser in schwarz-weiß hergestellten
Publikation erstellte
Michael Schieber
zusammen mit seiner damaligen Stellvertreterin 1994 einen reich
bebilderten Museumsführer, der mittlerweile in drei Sprachen
übersetzt und in dritter, erweiterter Auflage bis heute verkauft
wird. Keiner der nachfolgenden Museumsleiter hatte diesem Werk etwas
hinzuzufügen, wodurch der Museumsführer seit über 30 Jahren als
Standardwerk und wertvolle Hilfe für die Besucher angeboten wird.
Seit dieser Zeit wird der Band als Standardwerk und wertvolle Hilfe
für interessierte Besucher angeboten. Damit wirkt seine Arbeit bis
heute nach! |
|||||
 |
|||||
|
Bereits 1992 erfolgte mit Mitteln der
Freunde des RiesKraterMuseums e.V. eine der frühesten Beschaffungen
für das damals noch junge RiesKraterMuseum: Der 6080 Gramm schwere
Laos Muong Nong Tektit, welcher als einer der weltweit schwersten
Tektite dieser Art gilt und damit ein ganz besonders natürliches
Glas darstellt. Ähnliche Gläser sind als „Moldavite“ beim Einschlag
des Ries-Meteoriten entstanden. Am 4. März 1993 wurde der riesige
Tektit in trauter Runde offiziell der Sammlung des Museums
übergeben: Dr. Michael Schieber (links), Dr. W.-D. Kavasch (mittig
links), Prof. D. Stöffler (mittig rechts) und der damalige OB P.
Kling (rechts). Bild: Jochen Aumann, Nördlingen. |
|||||
|
Hinzu kommen
praktische Beiträge für zahlreiche Exkursionen von Schülern und
Studenten sowie die im Rahmen von Lehrerfortbildungen wie auch für
Volkshochschulen oder naturhistorisch-geologische Vereine
durchgeführten Veranstaltungen. Auch hier konnte er sein
umfangreiches Wissen, immer mit einer Prise Humor gewürzt, an eine
interessierte Hörerschaft weitergeben. Daneben erfolgten zahlreiche
Fernseh- und Rundfunkbeiträge, die
Michael
Schieber unterstützte oder daran
selbst mitwirkte. Herausragend waren hier sicherlich die
Filmarbeiten zum Lebenswerk von Prof. Dr. Eugene Shoemaker und
seiner Frau Carolyn. Das Ehepaar besuchte im Rahmen der Dreharbeiten
auch das RiesKraterMuseum und trug sich in das „Goldene Buch“ des
Museums ein. Unter seiner Leitung und Mitwirkung war das
RiesKraterMuseum immer wieder Gastgeber von nationalen und
internationalen Konferenzen, von denen beispielhaft die im Jahr 2000
stattgefundene AMICO (Asteroid and Meteorite Impacts and their
Consequences) und die im Jahr 2003 erfolgte LMI (Large Meteorite
Impacts) Fachtagung erwähnt werden sollen. Hinsichtlich der
Museumsleitung und -entwicklung stellte
Michael
Schieber bereits im ersten Jahr
seiner Tätigkeit fest, dass wenn „wir auch weiterhin und über Jahre
Besucher anlocken wollen, dann müssen wir in das Konzept neue Ideen
miteinfließen lassen“. Dabei sprach er nicht nur das fehlende
Museumsdepot an, welches erst viele Jahre später realisiert werden
sollte, sondern kümmerte sich kontinuierlich um Modernisierungen und
Erweiterungen der Dauerausstellung. So wurde Mitte der 1990er Jahre
die damalige Diaschau durch eine moderne Video-Projektion mit
unterschiedlichen Sprachversionen ersetzt. Durch die erfolgreiche
Zusammenarbeit zwischen dem Verein der Freunde des
RiesKraterMuseums, der Stadt Nördlingen und weiterer Sponsoren
wurden unter dem Museumsleiter Michael Schieber 1993 der
Eisenmeteorit „Guatelupe“, diverse Impaktite, 1996 der Meteorit
„Gao“, 2002 der Marsmeteorit „Zagami“, 2004 der große Meteorit
„Sikhote-Alin“ und natürlich der berühmte Meteorit „Neuschwanstein
I“ beschafft. Im Außenbereich entstand 2003 der bis heute gerne
genutzte geologische Lehrgarten. In seine Zeit fällt auch die
Gründung des Zentrums für Rieskrater- und Impaktforschung Nördlingen
(ZERIN) sowie die Überführung der 1.206 m tief reichenden
Forschungsbohrung Nördlingen 1973, die sich seither in Nördlingen
befindet. Für
Michael
Schieber mit seinem Museumsteam
waren die jährlichen Sonderausstellungen eine Herzensangelegenheit.
Im Laufe der Jahre konzipierte er ein weites Spektrum an
Sonderausstellungen, beginnend mit „Natürliche Gläser“, „Asteroiden,
Meteoriten, Kometen“, „Geotope im Rieskrater“ bis hin zu
Kunstausstellungen mit kosmischem Bezug. Seine Aktivitäten
erstreckten sich auch auf lokale Mitteilungen in der Tagespresse. So
haben wir erfahren, dass der „Schwabenstein“ nicht nur bei uns im
Nördlinger Ries vorkommt, sondern dass dieser in den 1950er und
1960er Jahren auch auf den Weltmeeren als Schiff unterwegs war. |
|||||
|
|||||
|
Michael Schieber hat über Jahrzehnte positiv auf das RiesKraterMuseum in Nördlingen gewirkt. Damit wird es einen wesentlichen Teil seines Lebenswerkes repräsentieren und sein wirklich prägender Musemsleiter wird stets in guter Erinnerung bleiben. Wir werden Michael Schieber immer als einen, an der Natur interessierten, ja die Natur liebenden Menschen in Erinnerung behalten, dessen kennzeichnendes Wesen allerdings seine Liebe zu den kosmischen Dingen mit ihren irdischen Auswirkungen war. Per aspera ad astra! Aus unseren Erinnerungen und dem Nachlass von Dr. W.-D. Kavasch erstellt |
|||||
|
Dr. Oliver Sachs 1. Visitzender des Vereins Freunde des RieskraterMuseums e.V. |
Gisela Pösges ehemalige stellvertretende Leiterin des RiesKraterMuseums |
||||
|
Verzeichnis seiner wichtigsten Publikationen zum nördlinger Ries:
Schieber, M.
(1985): Fossilfunde in Ries-Trümmermassen.-
Der Aufschluss,
36 Jahrgang, Heft 6, Seiten 197-199; Heidelberg.
Schieber, M.
(1989): Soil formation in displaced
Pleistocene aeolian sands in the Nördlinger Ries.- In: Frank Ahnert
[Ed.]: Landforms and Landform Evolution in West Germany - Published
in Connection with the Second International Conference on
Geomorphology, Frankfurt a.M., September 3-9, 1989,
Catena Supplements,
Vol. 15, pp. 269-278; Cremlingen.
Pösges, G. &
Schieber, M.
(1991): Das Rieskrater-Museum Nördlingen und sein geologisches
Umfeld.- Archaeopteryx -
Jahreszeitschrift der Freunde des Jura-Museums Eichstätt,
Nr. 9, Seiten 83-87; Eichstätt.
Pösges, G. &
Schieber, M.
(1992): Das Rieskrater-Museum Nördlingen und sein geologisches
Umfeld.- Meteor - Zeitschrift für
Meteoritenforschung, 7 Jahrgang,
Nr. 23, Seiten 14-19; Mainz.
Schieber, M.
(1992): Dinosaurier - Leben und Untergang. Sonderausstellung im
Rieskrater-Museum Nördlingen vom 14. Mai bis 4. Oktober 1992.-
Begleitheft zur Sonderausstellung
im Rieskrater-Museum, 28 Blätter;
Nördlingen.
Pösges, G. &
Schieber, M.
(1994): Das Ries. Führer durch das Rieskrater-Museum und
Empfehlungen zur Gestaltung eines Aufenthalts im Ries. Mit Beiträgen
von Frank, F., Grau, W. und Frei, H.-
Bayerische Akademie für Lehrerfortbildung
Dillingen, Akademiebericht, Nr.
253, 123 Seiten; Dillingen.
Pösges, G. &
Schieber, M.
(1994): Das Rieskrater-Museum Nördlingen. Museumsführer und
Empfehlungen zur Gestaltung eines Aufenthalts im Ries.-
Bayerische Akademie für Lehrerfortbildung
Dillingen, Akademiebericht, Nr.
253, 112 Seiten (erste Auflage), Verlag Dr. Friedrich Pfeil;
München.
Schieber, M.
(1994): Die Shatter Cone-Sammlung am Rieskrater-Museum Nördlingen.-
Natur und Museum - Bericht der
Senkenbergischen Naturforschenden Gesellschaft,
Band 124, Heft 7, Seiten 215-221; Frankfurt am Main.
Hüttner, R., Pösges,
G., Reiff, W. &
Schieber, M.
(1995): Nördlinger Ries und Steinheimer Becken. Exkursion 1 der 4.
Jahrestagung der Gesellschaft für Geowissenschaften zu Thema
Süddeutsche Großscholle am 14. Und 15. Juni 1995.-
Zeitschrift für geologische
Wissenschaften, Band 24, Hefte 1/2,
Seiten 121-139; Berlin.
Schieber, M.
(1994): Ein ungewöhnlicher Muong-Nong-Tektit.-
Sterne und Weltraum,
34 Jahrgang, Nr. 3, Seiten 196-198; Heidelberg.
Schieber, M.
& Pösges, G. (1995): Excursion guide für field trips through the
Ries crater. In: Workshop on meteorites from cold and hot deserts,
Lunar and Planetary Institute
(LPI) / NASA, Report No. 95-02, pp.
60-65; Huston (Texas).
Pösges, G. &
Schieber, M.
(1997): The Ries Crater Museum Nördlingen - Museum Guide.-
Bavarian Academy for Teacher Training
Dillingen, Academy Bulletin Nr.
253, 80 pages, Published by Dr. Friedrich Pfeil; Munich.
Schieber, M.
und Pösges, G.: Der Meteoritenkrater Nördlinger Ries. In: Regensburg
und Ostbayern mit Nachbarregionen – Geographische Streifzüge, Hrsg.
Martin Hartl und Max Huber, Auftrag des 26. Geographentages in
Regensburg 1998. München 1998, S. 129 - 135
Schieber, M.
(1998): Ein Shatter-Cone aus der Vredefort-Struktur (Impakt-Krater)
in Südafrika.-
Der Aufschluss,
49 Jahrgang, Heft 9/10, Seiten 315-320; Heidelberg.
Pösges, G.,
Pohl, J. &
Schieber, M.
(2000): Ries and Steinheim Impact Structures, Southern Germany.-
In: Koeberl, Chr. & Schönlaub, H.-P.
[Eds.]: Catastrophic Events & Mass Extinctions: Impacts and Beyond,
Geozentrum University of Vienna, July 9-12, 2000,
Field Trip Guide Book,
pp. 1-13; Vienna.
Pösges, G. &
Schieber, M.
(2002): Le Musée du Cratère du Ries Nördlingen - Guide du Musée.-
Académie bavaroise pour la
formation des professeurs Dillingen,
Bulletin d’académie N° 253, 80 pages, Éditeur Dr. Friedrich Pfeil;
Munich.
Schieber, M.
(2004): Aspekte des Geotourismus im Meteoritenkrater Nördlinger
Ries.- Der Aufschluss,
55. Jahrgang, Heft 4, Seiten 247-255; Heidelberg.
Pösges, G. und
Schieber, M.
(2004): Geographische und geologische Beobachtungen und
Erläuterungen zum Gemeindegebiet in Deiningen inmitten des Rieses.-
In: Gemeinde Deiningen [Ed.], zusammengestellt von Barsig, W. &
Stippler, K.: Deiningen inmitten des Rieses, Seiten 16-29,
Missionsdruckerei und Verlag Mariannhill; Reimlingen.
Pösges, G. und
Schieber, M.
(2005): Geologie und Landschaft im Gemeindegebiet von Hainsfarth.-
In: Gemeinde Hainsfarth [Ed.], zusammengestellt von Beck, G.: 1200
Jahre Hainsfarth – Ortschronik von Hainsfarth 2005, 17-27, Druckerei
und Verlag Steinmeier; Nördlingen.
Pösges, G. und
Schieber, M.
(2007): Geologische und geographische Besonderheiten in der
Gemarkung Gunzenheim.- In: Marktgemeinde Kaisheim [Ed.],
zusammengestellt von Dumberger-Babiel, W. & Ritter, M.: 1200 Jahre
Gunzenheim – Streiflichter aus der Ortsgeschichte, Seiten 51-64,
Druckerei Schmid; Kaisheim.
Schieber, M.
(2008): Ein paläoklimatisch überprägter Grundgebirgskörper in der
Megablockzone im Meteoritenkrater Nördlinger Ries.-
Der Aufschluss,
59. Jahrgang, Heft 11/12, Seiten 393-403; Heidelberg.
Rosendahl, W. &
Schieber, M.
(2009): Der Stein der Schwaben - Natur- und Kulturgeschichte des
Suevits - Kulturgestein, Band 4, 60 Seiten, Staatsanzeiger-Verlag;
Stuttgart.
Diedrich, H. &
Schieber, M.
(2009): Eine historisch-geologische Stadtwanderung durch
Nördlingen.- In: Rosendahl, W. & Schieber, M. [Eds.]: Der Stein der
Schwaben - Natur- und Kulturgeschichte des Suevits,
Kulturgestein,
Band 4, Seiten 34-39, Staatsanzeiger-Verlag; Stuttgart.
Pösges, G., Stangel,
H. & Schieber, M.
(2009): Suevit in der Nördlinger Museumsinsel.- In: Der Stein der
Schwaben. Natur- und Kulturgeschichte des Suevits.- In: Rosendahl,
W. & Schieber, M. [Eds.]: Der Stein der Schwaben - Natur- und
Kulturgeschichte des Suevits,
Kulturgestein, Band 4, Seiten
46-49, Staatsanzeiger-Verlag; Stuttgart.
Schieber, M.
(2009): Die "Schwabenstein"- In: Rosendahl, W. & Schieber, M.
[Eds.]: Der Stein der Schwaben - Natur- und Kulturgeschichte des
Suevits, Kulturgestein,
Band 4, Seite 58, Staatsanzeiger-Verlag; Stuttgart. Pösges, G. und Schieber, M. (2009): Otting – ein Landschaftsgemälde in Otting im Spiegel seiner Geschichte.- In: Gemeinde Otting [Ed.], zusammengestellt von Barsig, W.: Otting im Herzogtum Pfalz-Neuburg, Seiten 12-23, Missionsdruckerei und Verlag Mariannhill; Reimlingen. |
|||||
|
Sonderausstellung im RiesKraterMuseum |
|||||
|
|||||
|
Feldbeobachtungen und
Besonderheiten bei den Ribbeck-Meteoriten Kurzfassung des Originalartikels in der Zeitschrift „Regiomontanus Bote“, Ausgabe 2/24 – von Dietmar Rößler |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Erste Untersuchungen ergaben, dass es sich um einen sog. Achondriten der seltenen Stoffklasse „Aubrit“ handeln muss. Benannt sind diese Meteoriten nach der französischen Ortschaft Aubrés, wo 1836 erstmals ein Meteorit dieser Stoffklasse gefunden wurde. Diese Meteoriten können stark irdischen Gesteinen ähneln. Man vermutet, dass sie Trümmer ehemaliger Protoplaneten oder noch heute existierender Planeten (Mars Merkur) darstellen. Mineralbestandteile sind überwiegend Enstatit, untergeordnet können auch Eisensulfid (Troilit), Nickel-Eisen (Kamacit), Olivin und weitere Mineralien enthalten sein. Das Gestein hat ein grobkörniges Aussehen (Textur) und ist stark brekziiert. |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
How To Photograph The Moon: Ultimate (UPDATED) Guide |
|||||
|
|||||
| Abbildung: nightskypix.com | |||||
| Nordlicht über Nördlingen | |||||
|
In der Nacht vom 10. auf den 11 Mai 2024 konnte die AllSky Kamera des RiesKraterMuseums über mehrere Stunden hinweg Nordlichter über dem Himmel von Nördlingen erfassen. Foto des Nordlichts über Nördlingen aus der Filmsequenz der AllSky Kamera des RiesKraterMuseums.
Eine Animation ist hier zu sehen.
|
|
||||
|
|